Wo immer eine Kennzahl auftaucht, löst sie eine Art Pawlowschen Reflex bei Managern aus. Sofort wird die Kennzahl für Vergleiche eingesetzt, weil sich Zahlen ja so schön vergleichen lassen. Was aber wenn der Maßstab gar nicht der gleiche ist? In der Physik ist es uns klar, dass wir Zahlen nicht ohne Einheit verwenden dürfen, denn 42 Grad (Fahrenheit) kann deutlich kälter sein als 20 Grad (Celsius). Wenn es um die Zusammenarbeit von Menschen in Organisationen geht, ist man froh überhaupt irgendwas numerisch erfassen zu können und verliert schnell das Gefühl für die nicht vorhandene Vergleichbarkeit.
Wenn ein Team 20 Story-Points pro Sprint schafft und ein anderes 30, welches ist dann das produktivere? Die Frage klingt für kennzahlenverliebte Manager vernünftig und verlockend, ist so aber nicht wohlformuliert und kann nur beantwortet werden mit einem klaren: „Es kommt darauf an.“
Der erste Denkfehler liegt darin zu glauben, dass Story-Point gleich Story-Point sein muss. Dabei ist ein Story-Point einfach nur eine künstliche Einheit mit der ein Team den Aufwand von User-Stories bemisst. Innerhalb eines einzigen Teams sollte also unter einem Story-Point immer dasselbe verstanden werden. Das Team im Nachbarraum hat aber unter Garantie einen anderen Maßstab.
Der zweite Denkfehler ist subtiler. Story-Points messen den Aufwand für eine Anforderung, sind in diesem Sinne also ein Eingangsgröße. Am Ende zählt aber letztlich nur der Nutzen, den eine User Story bringt und nicht der Aufwand, den sie kostet. Insofern könnte man argmumentieren, dass sich Produktivität am Nutzen orientieren sollte anstatt am Aufwand. Die Produktivität einer Fabrik würde man ja auch nicht anhand der geleisteten Arbeitsstunden der Arbeiter messen, sondern anhand des Ausstoßes an Gütern pro Zeiteinheit.
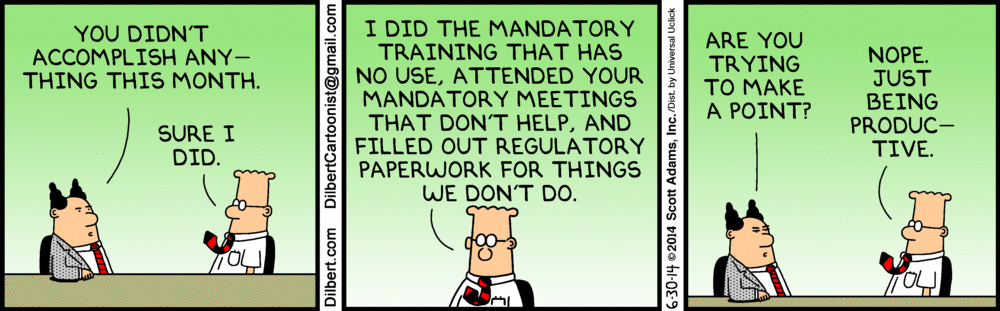
Trotzdem ist die Geschwindigkeit gemessen als Story-Points pro Sprint für das einzelne Team ein wertvolles Maß für die Fortschritte die das Team in Bezug auf die eigene Leistungsfähigkeit macht. Das setzt allerdings voraus, dass diese Kennzahl ein Werkzeug des Teams bleibt und nicht zu Vergleichen von Teams missbraucht wird. Dann ist sie nämlich wertlos: Für den Vergleich sowieso, aber auch für das Team, weil die Beobachtung von Außen die Messung beeinträchtigen wird. In dem Moment wird aus einen für das Team wertvollen Werkzeug ein Managementprozess, der die Arbeit behindert.
So much of what we call management consists in making it difficult for people to work.
Peter F. Drucker






3 Kommentare
Inhaltlich völlig richtig, jedoch halte ich die Analogie mit einer Fabrik für gefährlich.
Zwar ist auch in einer Fabrik der Zusammenhang nicht so simpel, wie in dem Beispiel dargestellt, dennoch gibt es in der Produktion häufig einen nachweisbaren, berechenbaren Bezug zwischen Eingangs- (Produktionsmittel) und Ausgangs-Faktoren (Produkte).
Genau da liegt ein Grund-Problem: Manager wenden oft die Modelle und Denkweisen aus der (industriellen) Produktion auf die Wissensarbeit an – dabei ist erstere überwiegend kompliziert (es gibt mit endlichem Aufwand vorausbestimmbare Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge), letztere jedoch überwiegend komplex (Ursache-Wirkungs-Zusammenhang kann erst hinterher festgestellt/gemessen werden – und der ist kaum übertragbar auf andere Situationen).
Danke für diesen wertvollen Hinweis auf die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Wissensarbeit und Produktion. Ein Grund mehr nicht einfach ohnehin überholte Modelle auf die Domäne der Wissensarbeit zu übertragen.
Dem stimme ich zu.
Die Effekte, die ich gesehen habe, als Modelle wie TQM, SixSigma etc. für die Wissensarbeit „mißbraucht“ wurden, unterstreichen das.
Aufgrund der Komplexität ist es letztlich extrem aufwendig, Produktionsprozesse in der Wissensarbeit (z.B. Engineering, Projektmanagement) umzusetzen, und der Aufwand für die Nachverfolgung ist entsprechend noch größer.
Dadurch ist man irgendwann nur noch damit beschäftigt, KPI zu pflegen, Ergebnisse zu zählen, und zu berichten.
Die eigentlichen Ergebnisse der Arbeit geraten da leicht ins Hintertreffen.