Ein entscheidender Gedankengang in der sehr lesenswerten Biografie von Götz W. Werner (Amazon Affiliate-Link) ist die Frage, ob der Mensch der Zweck des Unternehmens sei oder nur ein Mittel. Der dm-Gründer hat die Frage für sich recht früh und recht eindeutig beantwortet: »Ohne Menschen keine Wirtschaft. Folglich ist der Mensch immer Zweck und die Wirtschaft nur Mittel – und nicht umgekehrt.« Der Erfolg gibt ihm bisher uneingeschränkt recht. Was bedeutet das aber für Unternehmen der Dienstleistungsbranche?
Mit Menschen haben Dienstleistungsunternehmen notwendigerweise in zwei nur scheinbar entgegengesetzte Richtungen zu tun: Einerseits nach außen mit Kunden und andererseits nach innen mit Mitarbeitern. In beiden Richtungen gibt es viel Sonntagsreden und leere Worte und wenig konsequente Umsetzung der Leitlinie, den Menschen nicht zum Mittel werden zu lassen.
Wie selbstverständlich behaupten alle, der Mensch ob als Kunde oder Mitarbeiter stünde im Mittelpunkt. Allein der Alltag sieht anders aus. Gemessen und mit Boni versehen werden Umsatz und Auslastung. So werden Kunden zu Umsatzbringern und Mitarbeiter zu Ressourcen, deren Auslastung möglichst hoch sein sollte. Niemand interessiert, ob der Kunde das Projekt braucht oder will solange die Kasse stimmt. Und noch weniger interessiert, ob der Mitarbeiter das Projekt sinnvoll findet, ob er gern im Team arbeitet oder ob er sich entwickeln kann, schließlich wird er dafür entlohnt und hat daher – bitte schön! – zu funktionieren. Wer also diese Kennzahlen, Umsatz und Auslastung, derart zur Steuerung verwendet macht den Menschen zum Mittel. Daran ändern auch schöne Präsentationen und Aushänge mit den Werten des Unternehmens nichts.
Umsatz und Auslastung – und damit verknüpft letztlich der Gewinn – sind keine Ziele, sondern die Folge des wirtschaftlichen Handelns. Diese Kennzahlen zeigen nämlich, inwieweit die angebotene Dienstleistung nachgefragt wird. Steuern lassen sich diese Parameter nur indirekt durch das eigene Angebot und die eigenen Ergebnisse und Erfolge. Hier schließt sich dann aber der Kreis zwischen Kunde und Mitarbeiter, weil in der Dienstleistungsbranche in der Regel ein enger Kontakt zwischen Kunde und Mitarbeiter besteht. Mitarbeiter die sich nicht nur als Mittel fühlen, werden eher eigenverantwortlich, selbstständig und vertrauensvoll mit dem Kunden zusammenarbeiten. Das wiederum wird zu erstrebenswerten langfristigen und vertrauensvollen Partnerschaften zwischen Kunden und dem eigenen Unternehmen führen.
Und es wird zu zufriedeneren Mitarbeitern führen, die sich als Menschen im Unternehmen individuell entwickeln können in sinnvollen Projekten anstatt nur möglichst hoch ausgelastet zu werden. Der Gefahr des Sinnverlusts und des Ausbrennens der Mitarbeiter wird effektiv entgegen gewirkt und die Belohnung ist eine niedrige Fluktuation. So richtig diese Überlegungen theoretisch sind, so schwierig sind sie in der Praxis umzusetzen. Die Früchte dieser Leitlinie, dass der Mensch immer Zweck und niemals Mittel sein darf, lassen sich nämlich erst auf lange Sicht ernten und zeigen sich eben nicht schon nach einem Quartal.
Artikelbild: Caleb Roenigk bei flickr.com (CC BY 2.0)

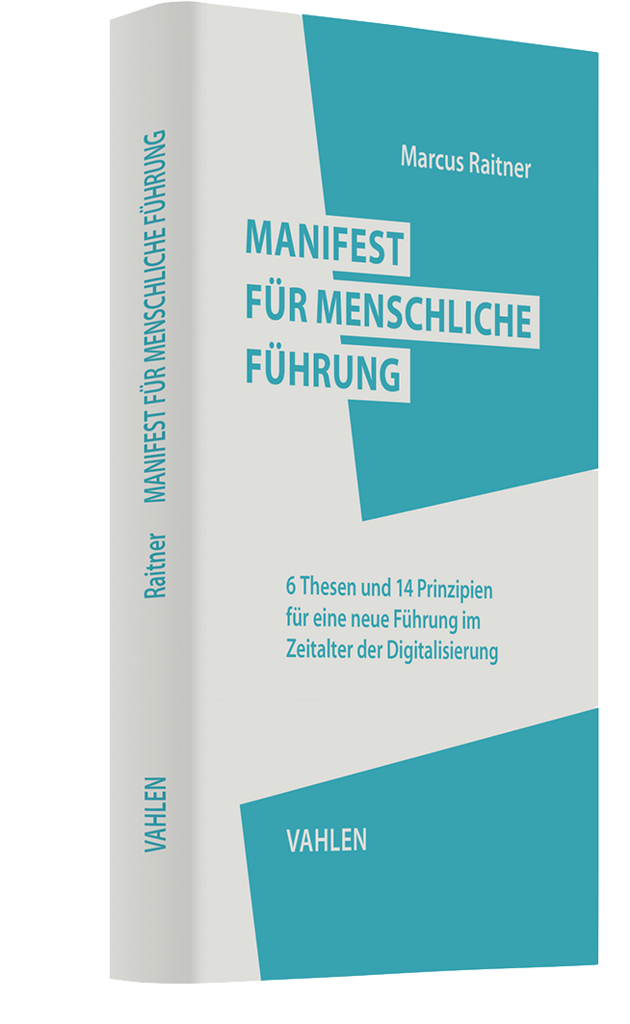
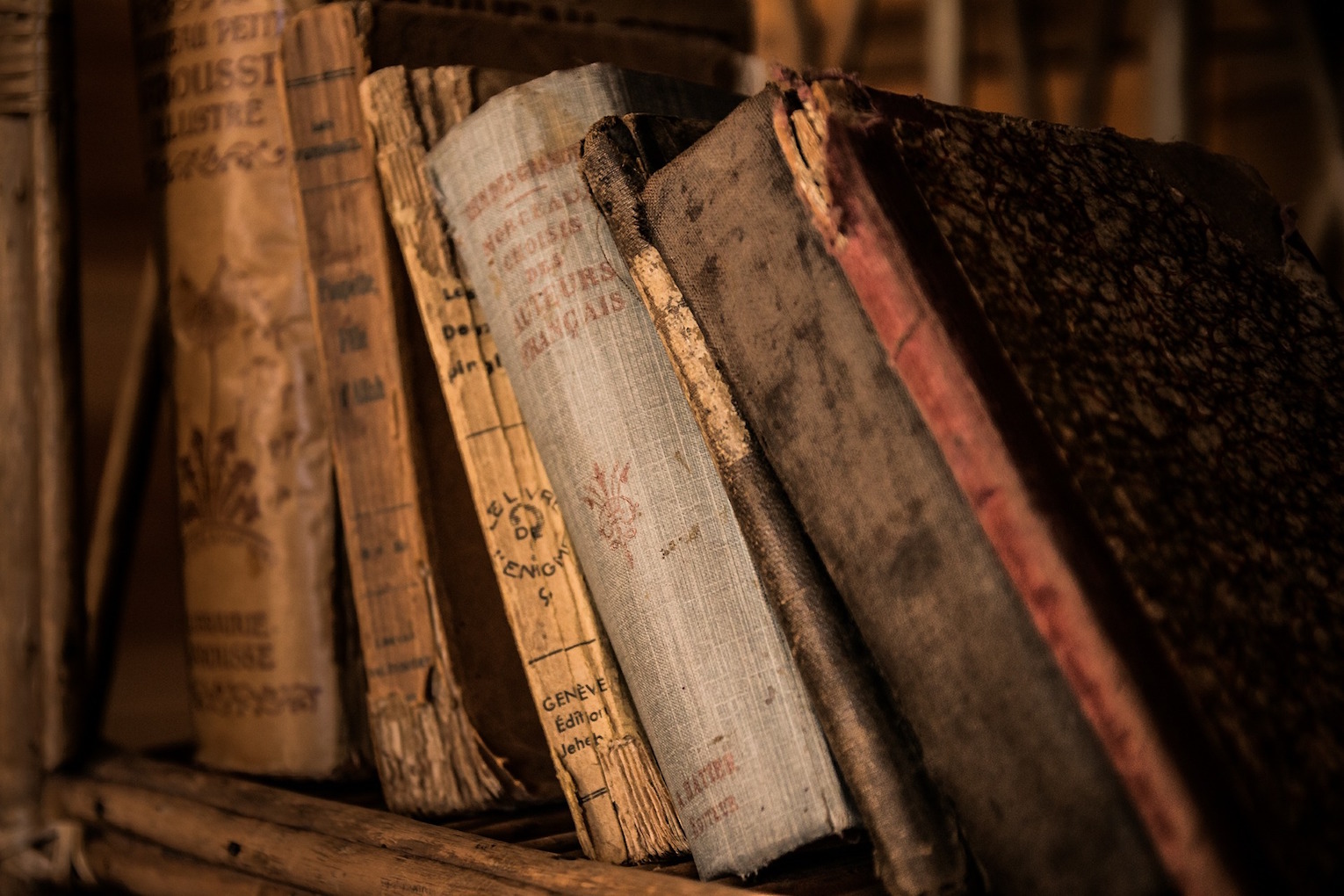

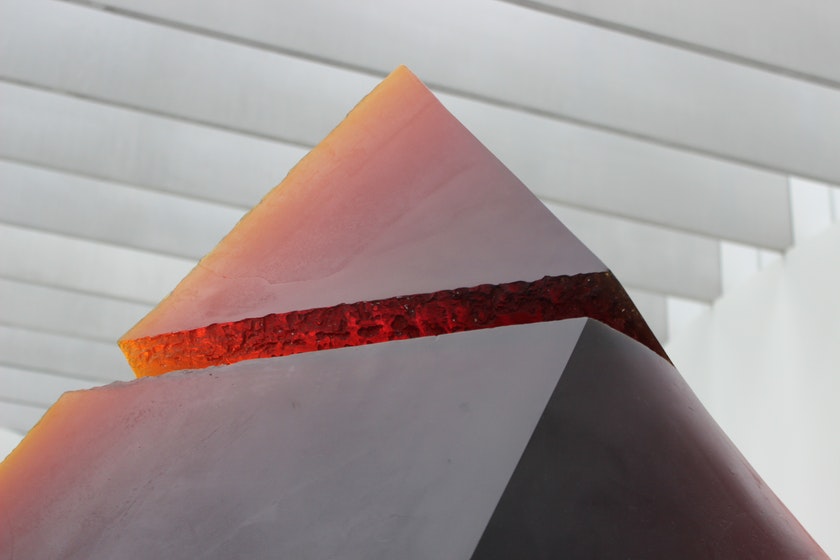
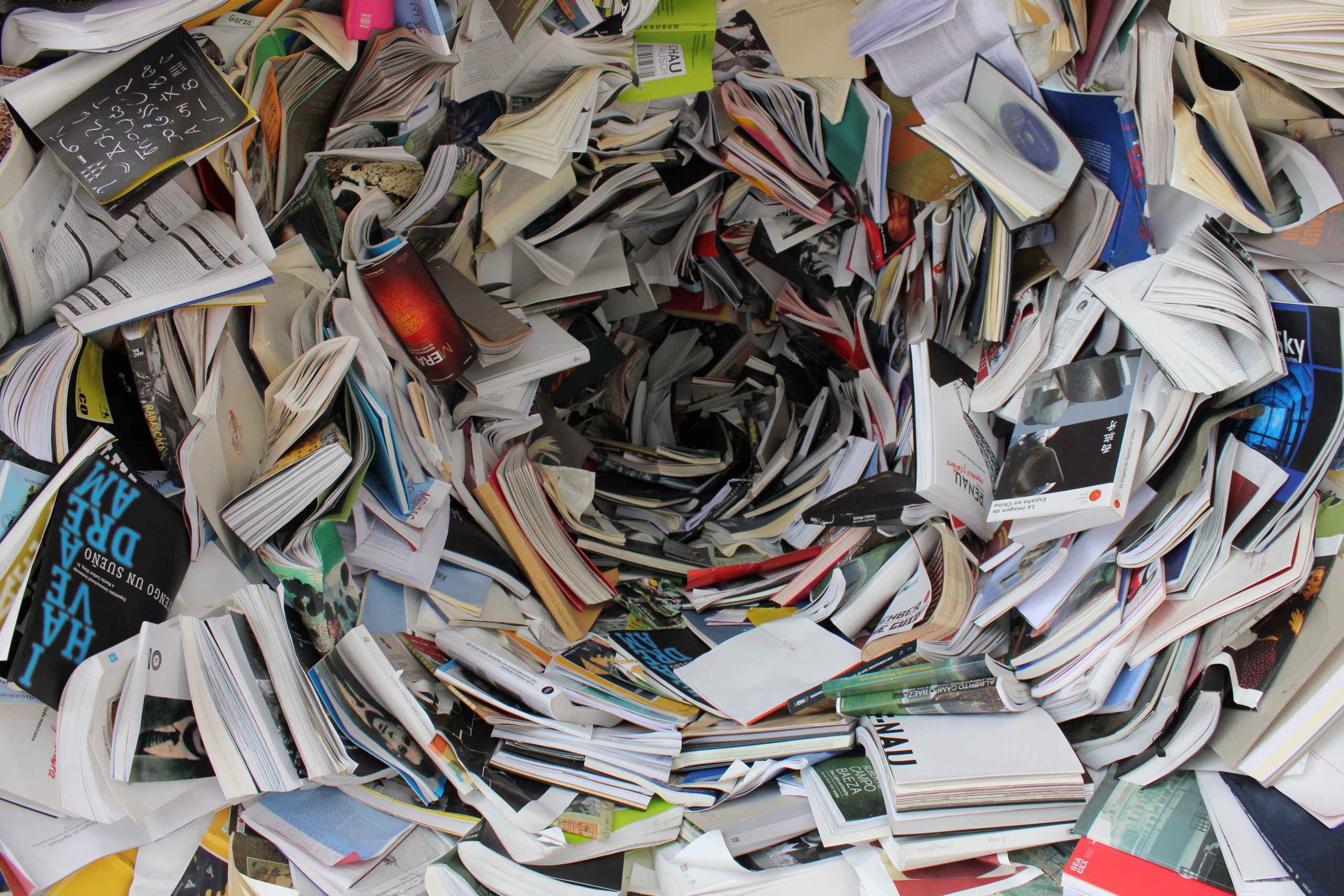
6 Kommentare
Hallo Marcus,
dieser Sicht kann ich 1:1 beipflichten.
Das Einzige, was mich irritiert, ist Dein Fokus auf die IT (auch wenn der naheliegend ist)
Schauen wir doch mal auf die Branche, in der ich arbeite: Die Energietechnik.
Die Konzerne in diesem Bereich setzen sich (im Wesentlichen) aus Fabriken und Dienstleistern zusammen. Andere Aufgaben wurden „outgesourcet“.
Ich bin ehrlich:
Ich halte die Produkte, die wir herstellen, für vollständig austauschbar mit denen des Wettbewerbs.
Nicht aber die Lösungen, die wir den Kunden bereitstellen. Diese Lösungen werden wiederum von vielen, individuellen Menschen erdacht und umgesetzt, die eigentlich nichts anderes wollen, als etwas Sinnvolles zu erschaffen. Dafür brauchen sie ein bestimmtes, die Kreativität förderndes Umfeld.
Und genau das bieten wir ihnen nicht.
Vielmehr opfern wir Kreativität und Sinnstiftung auf dem ach so heiligen Altar des „Shareholder Value“.
Kürzlich durfte ich mir einen unglaublich motivierenden Vortrag darüber anhören, daß unsere Daseinsberechtigung sei, den Aktionären ihre Dividenden zu erarbeiten.
Und niemand wundert sich, wenn die Mitarbeiter an der Stelle mit Unverständnis oder Abscheu reagieren…
Ich denke, wir sind uns einig, daß die grundlegende Idee von Aktionären und deren Gewinnerwartung legitim ist. Aber als einzige Grundlage dafür, wertvolle Lebenszeit in etwas zu investieren, das augenscheinlich nicht gewürdigt wird?
Das finde ich armselig.
Danke für Deinen Kommentar, Thilo. Der Fokus auf IT-Dienstleistung ist allein meinem beschränkten Erfahrungshorizont geschuldet. Und der Tatsache, dass ich hier getreu dem „allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Schreiben“ auch immer über unsere Firma nachdenke. Ich habe mittlerweile den Artikel überarbeitet und Richtung Dienstleistungsunternehmen verallgemeinert. Was mich immer erstaunt, dass nur so wenige gegen dieses kranke Wirtschaften aufbegehren und so viele die Fokussierung auf den Shareholder-Value als gegeben hinnehmen. Motivierend ist es jedenfalls nicht. Und da tut es gut, von Unternehmen wie dm zu lesen, das eben anders denkt und handelt und damit erfolgreich ist.
„Ich denke, wir sind uns einig, daß die grundlegende Idee von Aktionären und deren Gewinnerwartung legitim ist.“
Ist es das wirklich? Sicherlich in dem Konzept unseres Jahrtausende alten patriarchalen Systems, in dem wir erlauben, dass die Einen auf Kosten der Anderen leben dürfen, weil sie Besitz haben und die anderen nicht.
In einer Gesellschaft, die sich auf Augenhöhe organisiert, siehe z.B. in großen Tileen die Genossenschaften, wird eine Shareholder-Schaft eher als Raub an der Arbeitskraft betrachtet werden. Das Sklaventum hat sich doch dann nur verwandelt, indem die Ketten nur mit dem Geld (strukturell) getauscht wurde. Als die Leibeigenen „freigelassen“ wurden, gab man ihnen nicht das Nötige mit, um wirklich frei zu sein. Wer kein Land hat, um sich selbst zu versorgen, muss seinen Körper in den Dienst eine Herren stellen, den er sich zumindest noch aussuchen kann.
Durch diese neuen Freiheiten fühlen sich die Menschen zumindest in mehr Teilen selbstbestimmt. In vielen Unternehmen ist diese Selbstbestimmtheit allerdings noch wenig gegeben.
Viele Grüße
Martin Bartonitz
Martin, danke für das Feedback.
Als ich den Satz schrieb, wollte ich eigentlich um das Thema Shareholder herumarbeiten.
Mir ist hier vor allem die Differenzierung wichtig:
Die „grundlegende Idee“ der Aktien sehe ich so, wie sie früher einmal war, und sich jetzt im Kickstarter-Milieu manifestiert. Eine Gruppe von Geldgebern findet sich zusammen, um ein sinnvolles oder spannendes Produkt zu ermöglichen, das ihnen dann einen Nutzen bringt, zum Einen durch das Produkt an sich, zum Anderen durch eine Teilhabe am Geschäftserfolg.
Die „real existierende“ Umsetzung dieser Idee in der Wirtschaft weicht davon erheblich ab: Die Aktionäre kaufen Anteile an einem Unternehmen, ohne sich für dessen Geschäftszweck zu interessieren. Vielmehr läuft das Geschäft nach der Art „ich gebe Dir ein bisschen Geld, und Du zahlst mir regelmäßig steigende Dividenden, egal wie Du das machst“.
(Klingt ein bisschen nach Schutzgeld, oder?)
Die Krönung des Ganzen hat sich bei verschiedenen Unternehmen kürzlich gezeigt, die aufgrund zu geringer Gewinne (nicht Verluste, nur zu wenig Gewinn) ihren Shareholdern zuliebe die halbe Mannschaft gefeuert haben.
Und das ist eine grobe Perversion des Ganzen.
Die Frage, die sich mir stellt ist allerdings, ob die Finanzierung gemeinschaftlich förderlicher Projekte nicht besser von der Gemeinschaft ohne ohne Zins gewährt wird.
Dazu müssten allerdings unsere Politiker den Arsch in der Hose haben, und das Monopol der Giralgeldschöpfung wieder in die Gemeinschaft selbst holen. Der letzte, der es versucht hatte, war JFK. Danach war Ruhe. Aber es werden immer mehr, die sich trauen, über unser krudes Geldsystem zu schreiben. Hier ein Beispiel:
http://wirdemo.buergerstimme.com/2013/10/wie-das-muster-der-gesellschaftskrisen-durchbrechen/
Wer weiß, wie das Geldsystem aufgebaut ist, wird verstehen, warum sich die Schere zwischen Reich und Arm zwingend öffnen muss. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir auf Kosten Anderer zu leben erlauben.
Viele Grüße
Martin
Danke für eure anregende Diskussion, Martin und Thilo! Je tiefer man in unser Wirtschafts- und Kapitalmarktsystem einsteigt, desto mehr erkennt man tatsächlich die Defizite. Vielleicht gab es dahinter Mal eine gute Absicht, die allerdings schon lange nicht mehr sichtbar ist. Kurzfristig wäre ich schon glücklich wenn es mehr echte Unternehmer vom Schlage eines Götz Werner gäbe und weniger Manager.