Weniger, aber besser. Diesen Leitspruch des berühmten deutschen Designers Dieter Rams würde ich mir auch für Vorgehensmodelle wünschen. Je mehr Rollen ein Vorgehensmodell enthält und je mehr mehr dieser Rollen „Manager“ enthalten, desto kaputter ist es.
Organisationen geben ihren vielen Projekten mit einem Vorgehensmodell gern einen festen Orientierungsrahmen zur Durchführung. Ein solches Modell beschreibt also die Art und Weise, wie in der jeweiligen Organisation Projekte durchgeführt werden, welche Phasen und Ergebnisse erwartet werden und auch welche Rollen es geben muss oder kann. So weit, so verständlich.
In Projekten gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben, die ganz unterschiedliche Expertise verlangen. Gerade diese Interdisziplinarität kennzeichnet ja ein Projekt. In Softwareprojekten wird spezifiziert, programmiert, gebaut, installiert, getestet, betrieben und vieles mehr. Die Aufgaben müssen im Team verteilt und erledigt werden. Und es schadet dazu auch sicher nicht die Aufgaben zu beschreiben. Ob es dafür jeweils Rollen und Rollenbeschreibungen braucht, ist allerdings eine ganz andere Frage.
Unterscheide ohne zu trennen – verbinde ohne zu egalisieren.
Herbert Pietschmann
Eine Rolle hat auch immer etwas Trennendes. Es werden neben den Aufgaben auch Kompetenz (was darf diese Rolle entscheiden) und Verantwortung (wofür ist diese Rolle verantwortlich) beschrieben. Und damit eben auch, was die Rolle nicht entscheiden darf und wofür sie nicht verantwortlich ist. Vorgehensmodelle mit vielen Rollen und detaillierten Rollenbeschreibungen sehen Projekte also eher mechanistisch. Wie bei einer Maschine werden die Komponenten und wie sie zusammengesetzt werden beschrieben. Die Grundidee dabei ist, dass die Maschine wie geplant funktioniert, wenn jedes Teil seine Funktion wie beschrieben erfüllt. Die Einzelteile kümmert es dabei nicht und muss es auch nicht kümmern, welchen Zweck die Maschine erfüllen soll.
Traditional hierarchies and their plethora of built-in control systems are, at their core, formidable machines that breed fear and distrust.
Frederic Laloux
Für wiederkehrende, planbare und immergleiche Tätigkeiten ist diese mechanistische Sichtweise effizient und zielführend. Sobald allerdings, wie bei den meisten Projekten, Unsicherheit in Spiel kommt und der Weg zum Ziel gemeinsam gefunden werden muss, sind abgegrenzte Rollen keine Lösung, sondern ein Problem. Statt nebeneinander (und oft genug gegeneinander) die Aufgaben abzuarbeiten, braucht es mehr Miteinander im interdisziplinären Team mit einem klaren Blick auf den gemeinsamen Auftrag und die gemeinsame Verantwortung. Agile Modelle wie Scrum oder Kanban kennen daher auch nur ganz wenige Rollen.
Letztlich sind Vorgehensmodelle mit ihrem Dickicht an Rollen aber auch nur Abbild der umgebenden Organisation. Je mechanistischer und je höher der Grad an funktionaler Teilung, desto mehr Rollen werden auch den Projekten vorgeschrieben. Das Ergebnis sind seelenlose Projektmaschinen vom Fließband, in denen jeder penibel auf seine Aufgabe schaut und die Schuld beim anderen sucht. Eine fatale Konstellation bei immer komplexer werdenden Aufgabenstellungen, die nur noch miteinander durch gemeinsames Ausprobieren und Lernen bewältigt werden können.
The story of the global workforce is a sad tale of wasted talent and energy.
Frederic Laloux

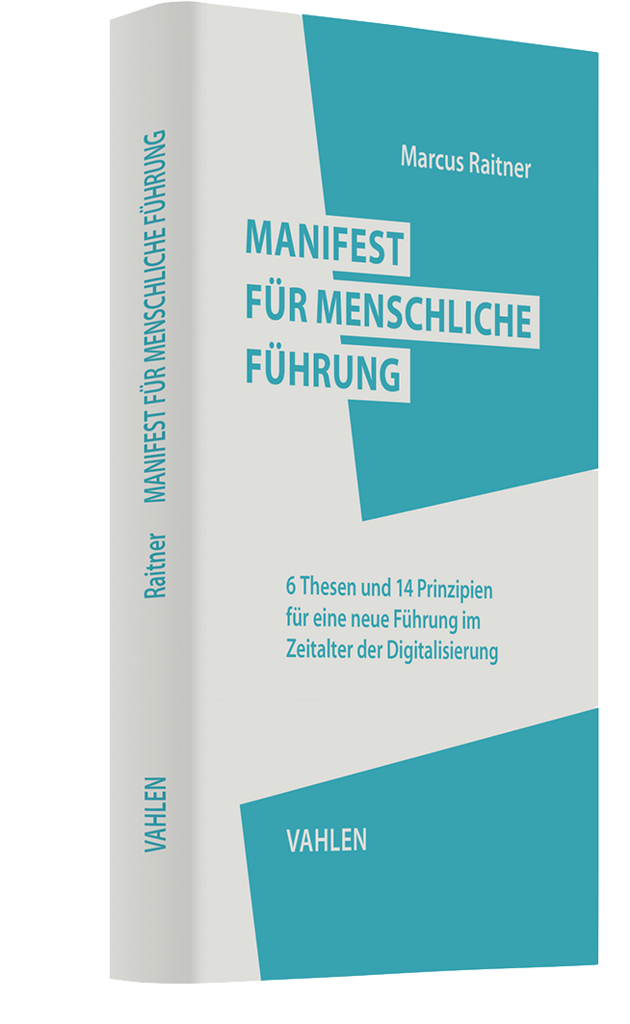




4 Kommentare
Hallo Marcus, volle Zustimmung, uns treibt offensichtlich gerade ähnliches um, LG Eberhard
http://www.pentaeder.de/projekte/2016/04/25/projekt-splitter-1-so-einfach-wie-moeglich/
Offensichtlich. Danke für den Link und die schönen Zitate mit Quellenangaben.
Marcus, Du beschreibst hier eine für mich gefühlt relativ neue Entwicklung.
Ich hatte seinerzeit (nach dem PMCamp Dornbirn) schon mal eine der Auswirkungen hingewiesen.
https://thilographie.wordpress.com/2015/11/30/mu5terbr3chen-holschuld-bringschuld/
Nicht die Rollenbeschreibung an sich ist das Problem, sondern das ständige „Zurechtstutzen“ der Mitarbeiter, wenn sie (im Interesse des Projektes) rein theoretisch definierte Kompetenzen überschreiten.
Dann folgt „Dienst nach Vorschrift“ im schlechtesten Sinne.
Ob und inwieweit das eine neue Entwicklung ist oder in letzter Zeit schlimmer wurde, hatte ich noch gar nicht überlegt. Vielleicht liegt das ja auch an der zunehmenden Unsicherheit in der sich Unternehmen und Projekte bewegen: Dann tendiert man leicht dazu sich stärker in Rollen und Prozesse zu flüchten und abzugrenzen.