Cal Newport ist es gelungen, mit seinem neuen Buch „Slow Productivity“ (Newport, 2024) an seinen Klassiker „Deep Work“ (Newport, 2016) anzuknüpfen. Treffsicher analysiert er, wie es zu dem beklagenswerten Mangel an echter konzentrierter Arbeit für die meisten Wissensarbeiter im 21. Jahrhundert kommen konnte und wie die plötzliche Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice während der Coronapandemie das Fass zum Überlaufen brachte.
Im Zentrum dieser Herleitung steht der Begriff der „Pseudo-Produktivität“, den Newport so definiert: „Die Nutzung von sichtbarer Aktivität als primäres Hilfsmittel zur Schätzung der tatsächlichen Produktivität.“ Anders als in der Landwirtschaft, wo einfach der Ertrag pro Hektar gewogen werden kann und anders als in der Massenfertigung, wo einfach der Ausstoß der Fabrik bestimmt werden kann, fehlt für Wissensarbeit eine verlässliche Methode, um Produktivität zu messen. Als Annäherung dient dann, was leicht gemessen werden kann: Stunden im Büro, schnell beantwortete E‑Mails etc.
Nur leider korrelieren diese messbaren Indikatoren nicht mit guter Wissensarbeit. Aber da sie gemessen werden, richtet sich die Arbeit danach aus. Das führt dazu, dass wir unsere Arbeitstage in zu vielen Besprechungen verbringen, während wir dazwischen und teilweise auch gleichzeitig vergeblich versuchen, der Nachrichtenflut Herr zu werden. An „Deep Work“ ist unter diesen Umständen nicht zu denken. Diese Entwicklung war vor 2020 schon bis an den Rand des gerade noch Erträglichen eskaliert, aber die Verlagerung der Arbeit ins Homeoffice und in endlose Videokonferenzen war der Kipppunkt, der schließlich in Phänomene wie „Die große Kündigungswelle“ („The Great Resignation“) oder „Stilles Kündigen“ („Quiet Quitting“) resultierte.
Den Kern von Cal Newports Philosophie „Slow-Productivity“ bilden die folgenden drei Prinzipien, im Buch gekonnt illustriert mit vielen inspirierenden Anekdoten und ergänzt um konkrete und bisweilen durchaus subversive Empfehlungen zur Umsetzung.
Weniger Dinge (gleichzeitig) tun
Da schlägt mein Herz als Verfechter agiler Methoden natürlich höher. Wer an zu vielen Dingen gleichzeitig arbeitet, verstopft das System und produziert am Ende mehr Reibungshitze als echte Ergebnisse. Das Hauptargument von Cal Newport ist hierbei, dass jedes laufende Projekt immer mit nicht wertschöpfenden Aufwänden zur Koordination einhergeht. Wenn zu viele gleichzeitig in Arbeit sind, wird schnell nur noch Arbeit koordiniert und nicht mehr gearbeitet. Hier gilt also, was schon im Zentrum von Kanban steht: An weniger Dingen gleichzeitig arbeiten. Das mag sich zwar weniger beschäftigt anfühlen, erhöht aber den Durchsatz und damit die Produktivität enorm.
In natürlichem Tempo arbeiten
Nur Projekt-Manager glauben, dass neun Frauen ein Baby in einem Monat austragen können. Cal Newport geht es bei diesem Prinzip darum, den Dingen die nötige Zeit zur Entfaltung und Reife zu geben. Er setzt damit ganz bewusst einen Gegenpunkt zur oft in sozialen Medien stolz zur Schau getragenen „Hustle-Culture“. Langsam ist besser: „Slow is smooth, smooth is fast“ lautet daher ein Grundsatz der Navy Seals. Neben dieser offensichtlichen Ausprägung dieses Prinzips stellt er den weitaus interessanteren Gedanken der Saisonalität zur Diskussion. Die ganzjährig gleich intensive Arbeitsbelastung ist ein unnatürlicher Zustand. Es hat für Newport, der im Hauptberuf als Informatik-Professor eine saisonal wechselnde Arbeit an einer Uni sehr zu schätzen weiß, einen großen Wert, wenn sich Phasen mit hoher Intensität mit weniger belastenden Phasen abwechseln.
Auf Qualität achten
Cal Newport definiert dieses Prinzip, das für ihn die Klammer um die anderen beiden bildet, im Buch so: „Achten Sie auf die Qualität Ihrer Ergebnisse, auch wenn dies bedeutet, dass Sie kurzfristig Chancen verpassen. Nutzen Sie den Wert dieser Ergebnisse, um langfristig mehr und mehr Freiheit in Ihren Bemühungen zu gewinnen.“ Es geht ihm nicht um Perfektionismus, sondern darum, das aufzubauen, was er viel früher (Newport, 2012) schon „Karrierekapital“ (career capital) genannt hat: seltene und wertvolle Fähigkeiten. Die damit einhergehende Reputation kann dann genutzt werden, um die eigenen Handlungsoptionen zu erhöhen und etwa weniger zu arbeiten oder an einem Ort der Wahl zu arbeiten oder an den interessantesten Projekten. Wer etwas anzubieten hat, kann Forderungen stellen. Und hier zählt eben nicht die auf Pseudo-Produktivität optimierten Fähigkeit besonders schnell E‑Mail Pingpong zu spielen, hier zählt einzig die Qualität der Ergebnisse.
Fazit
Cal Newport plädiert mit seiner Philosophie „Slow Productivity“ für eine Abkehr vor vordergründiger Pseudo-Produktivität und für eine Rückbesinnung auf handwerklich gute Wissensarbeit. Er analysiert dabei die systemischen Rahmenbedingungen in Organisationen, genauso wie die Einflüsse moderner Kommunikationstechnologie. Und er hält zahlreiche Ratschläge bereit, wie es dem Wissensarbeiter im 21. Jahrhundert trotzdem gelingen kann, nach diesen Prinzipien seiner Philosophie zu arbeiten.
Literatur
Newport, C. (2012). So good they can’t ignore you: Why skills trump passion in the quest for work you love (1st ed). Business Plus.
Newport, C. (2016). Deep work: Rules for focused success in a distracted world (First Edition). Grand Central Publishing.
Newport, C. (2024). Slow productivity: The lost art of accomplishment without burnout. Portfolio/Penguin.

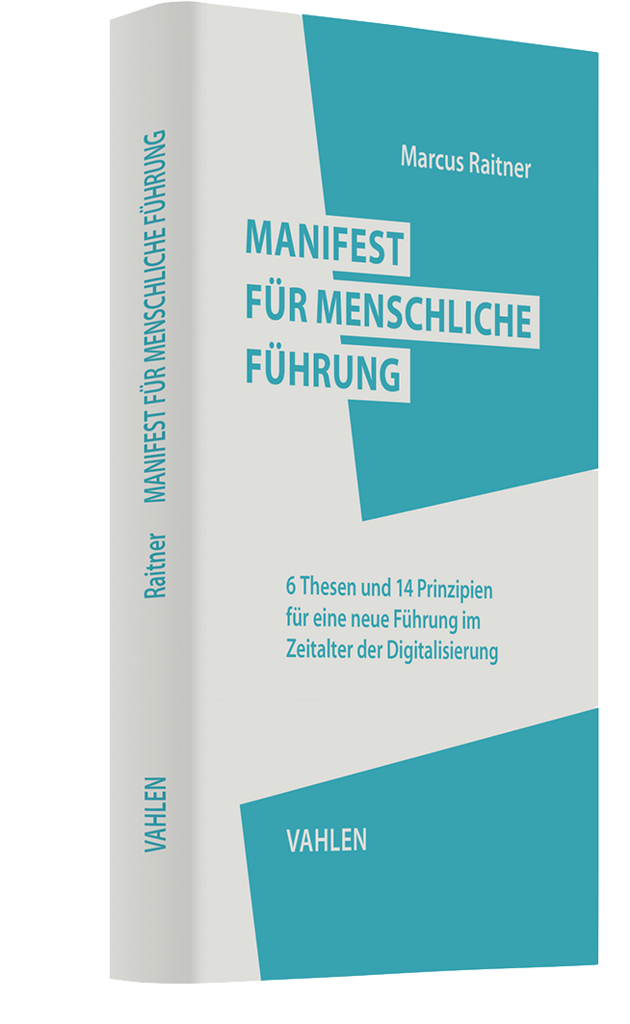
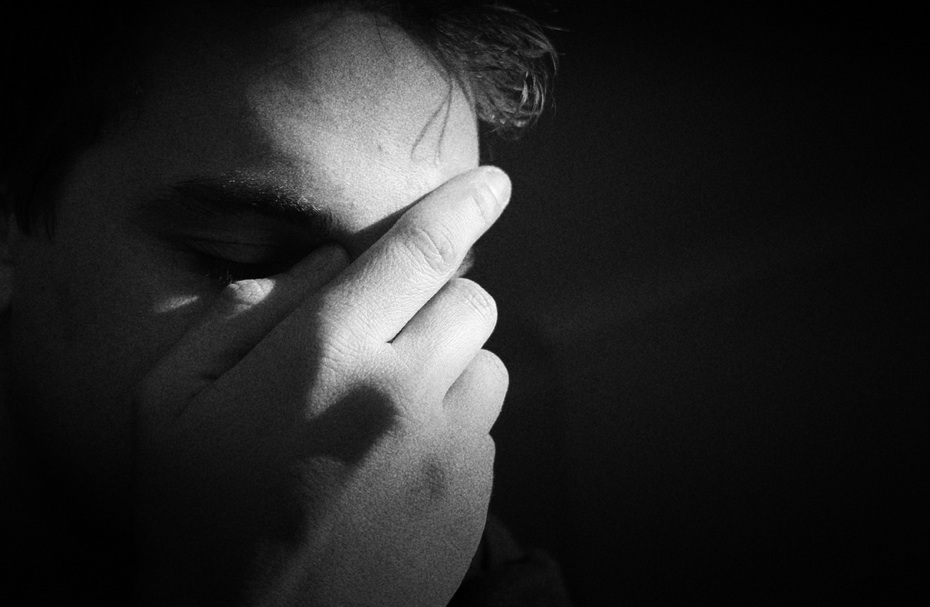
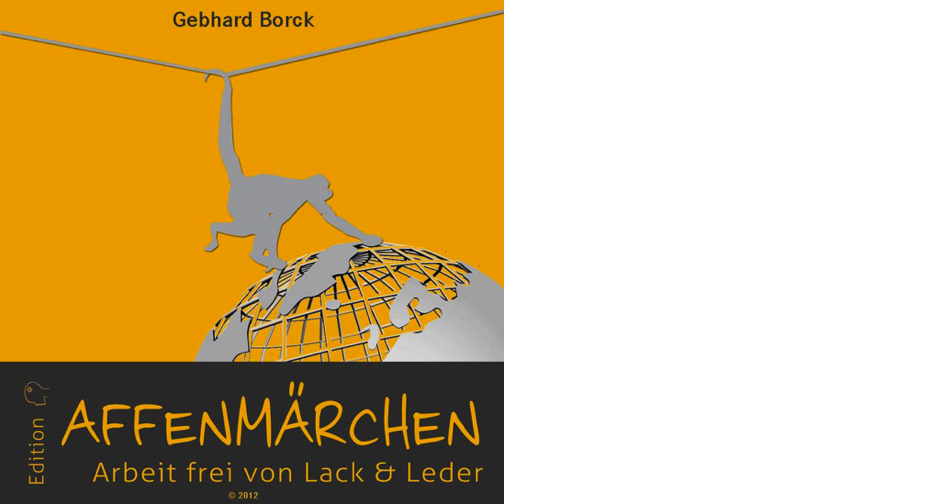
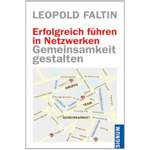
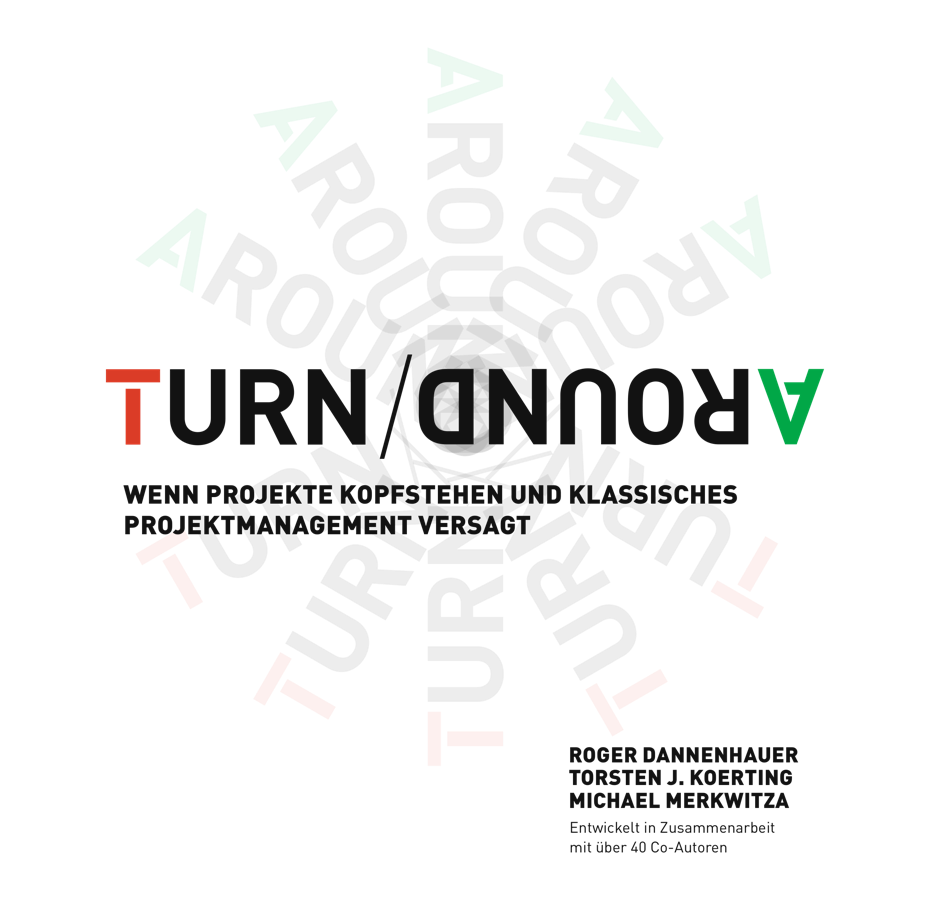
2 Kommentare
Es soll Arbeitgeber geben, die der Meinung sind, dass man an 4 Arbeitstagen mit 9h Arbeitszeit „Ressourcen“ effizienter nutzt als an 5 Arbeitstagen mit 8h Arbeitszeit.
Ich halte das ja für eine Fake Idee.
Ich werde es für euch herausfinden.
Lieber Oli, allein der Begriff „Nutzung von Ressourcen“ klingt in dem Zusammenhang schrecklich falsch. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass durch die Beschränkung der verfügbaren Arbeitszeit der Parkinson-Effekt durchaus für mehr Produktivität sorgen könnte durch die stärkere Beschränkung auf das Wesentliche. Aber 4 x 9h klingt für mich nicht nach einem Ansatz.